| |
Geografische Lage
|
| Das mitteleuropäische Buntsandstein-Becken (auch als Germanisches
Becken bekannt) lag zu seiner Entstehungszeit paläogeografisch etwa
auf der Höhe des heutigen Nordafrikas zwischen 10° und 30°
nördlicher Breite im Süden des Kontinents Laurasia. Es war ein
intrakontinentales, das heißt vom Meer abgeschlossenes Becken im
Bereich der großen Wüsten. |
| |
| Das Buntsandstein-Becken lag lange Zeit über dem Meeresspiegel.
Es nahm den Schutt der umliegenden, sich langsam hebenden Landmassen auf.
Vom Südwesten Abtragungsprodukte aus dem Gebiet des heutigen Zentralmassifs,
vom Süden Sedimente vom Vindelizischen Land und vom Osten Gesteine
aus der Böhmischen Masse. Flüsse transportierten den Schutt als
Sand, Gerölle und Konglomerate in das abflusslose Buntsandstein-Becken. |
| |
| In knapp 10 Millionen Jahren kamen bis zu 1.200 Meter Sandstein im
Norddeutschen Buntsandstein- Becken zusammen, im unterfränkischen
Raum nur unweit nördlich des Vindelizischen Landes - also mehr in
Randlage - immerhin noch rund 500 Meter Sandstein. |
| |
| |
Klima
|
| Schon auf Grund seiner geografischem Lage im Wüstengürtel
der Erde war es im Buntsandstein-Becken überwiegend heiß und
trocken. Die rote Färbung der Sandsteine beruht auf intensiven Oxidationsprozessen
- "verrosten" - der im Gestein enthaltenen Eisenverbindungen während
der trocken-heißen Phasen. |
| |
| Der Pflanzenbewuchs war sehr spärlich - Schachtelhalme, Farne,
Koniferen -, doch ermöglichten immer wieder aufkommende starke Niederschläge,
dass sich im Buntsandstein-Becken das Leben entfalten konnte. Während
der Niederschlagsphasen durchzogen breite Flüsse das Gelände.
Das Wasser ergoss sich in abflusslose Seen, die sich zu einer gewaltigen
Seenlandschaft verschmelzen konnten. Dies ermöglichte immer wieder
auch Tieren wie Stegocephalen, Echsen und Raubsauriern in diese sonst lebensfeindliche
Landschaft vor zu dringen. |
| |
| Für den Mittleren Buntsandstein kann auch eine zeitweilige Meeresüberflutung
des Beckens nicht ausgeschlossen werden. |
| |
| Durch die starke Verdunstung im Becken trockneten die Seen als bald
wieder ein. Es kam zeitweise zu Salzablagerungen. Markante Beispiele sind
im unterfränkischen Buntsandstein die Sand-Steinsalz-Kristalle. |
| |
| Die Röttonsteine des Oberen Buntsandsteins markieren kräftige,
erste Meeresvorstöße aus dem Norden ins Germanische Becken.
Das Wasser wurde jedoch wegen seiner geringen Tiefe im heißen Klima
noch mehrfach eingedampft. |
| |
| |
Sedimentation
|
| Die Sedimente im Buntsandstein-Becken stammen überwiegend von
den umgebenden Landmassen, die während Zeiten großer Niederschläge
und damit anschwellender Flüsse bis weit in das Becken geschwemmt
wurden. |
| |
| Die Sedimentation der Sandsteinpakete erfolgte dabei in trockeneren
Klimaperioden überwiegend durch Windverfrachtung der Abtragungsprodukte.
Gröbere Sedimente finden sich jedoch nur am Rand des Buntsandstein-Beckens.
In den Spessart-Sandsteinen gefundene Gerölle deuten auf zeitweise
sehr nahe Abtragungsgebiete hin. |
| |
| Die Tonsteine entstammen feuchteren Perioden zu Zeiten großer
Niederschläge und Ausbildung einer Seenlandschaft im Becken. Die feinen
Partikel im schlammigen Seegrund verfestigten sich über die Jahrmillionen
hinweg zu diesem Gestein. |
| |
| Analysiert man die Bundsandstein-Schichten etwas genauer, kann man
eine sich mehrfach wiederholende Abfolge von gröberen Sanden über
Feinsande bis hin zum feinkörnigen Tonstein verfolgen. So lassen sich
etwa alle 10 bis 15 Meter Profilhöhe Kleinzyklen beobachten, die auf
einen Wechsel von trockenem zu halbtrockenem Klima innerhalb eines Zeitraumes
von rund 100.000 Jahren hindeuten. Dieser Zeitraum entspricht einer periodischen
Änderung des Ellipsenradius der Erdumlaufbahn um die Sonne. |
| |
| Das ganze wird von tektonisch bedingten Ablagerungszyklen überlagert.
Die Sedimentation wurde in Gebieten geringer, in denen die tektonische
Senkung im Becken aufhörte oder gar wieder eine Hebung statt fand.
Die Sedimentation erfolgte in Gebieten mit starker tektonischer Senkung
um so stärker. |
| |
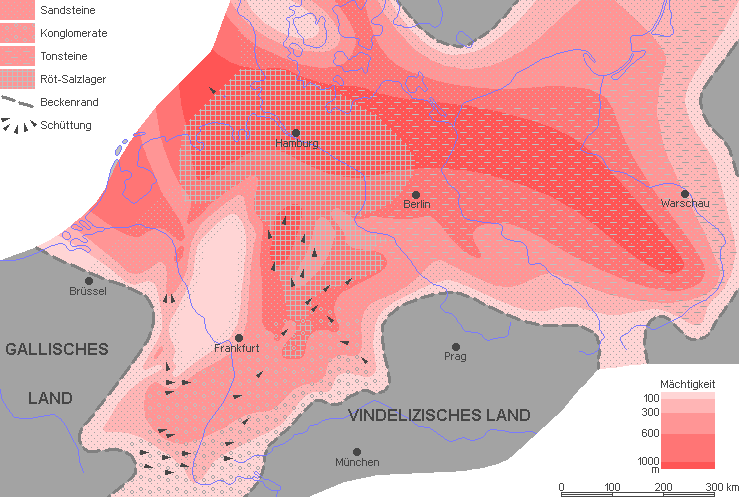 |
| |
| Bild 1: Das Buntsandsteinbecken in Mitteleuropa. |
| |