| |
| Die Erforschungsgeschichte des unteren Abschnitts der Germanischen
Trias, des Buntsandsteins, ist eng verbunden mit dem Namen eines Tieres,
von dem lange Zeit die genaue Gestalt, die Größe und die Lebensweise
nicht bekannt waren, dem Chirotherium oder "Handtier". Heute, schon
bald 200 Jahre nach den ersten Funden, scheint das Rätsel langsam
gelöst zu werden und das Tier nimmt Gestalt an. |
| |
| |
Erste Funde
|
| Bereits 1813 fanden Steinbrucharbeiter in den Sandsteinbrüchen
von Corn-cockle-Muir in Dumfrieshire (Schottland) tierfährtenähnliche
Abdrücke auf Sandsteinplatten. Einige Abdrücke wurden 1827 von
GRIERSON und DUNCAN gesammelt und Prof. W. BUCKLAND in Oxford vorgelegt,
der Sie als Fährten von Landschildkröten deutete. 1824 im "bunten
Sandstein" von Tarporley in Cheshire (England) gefundene Fährten blieben
noch einige Zeit ohne Bestimmung. |
| |
| Im Frühjahr 1833, 20 Jahre nach den ersten Funden, machte der
Gymnasialdirektor und Konsistorialrat F. K. L. SICKLER aus Hildburghausen
in Thüringen in den Bausteinen zu seinem Gartenhaus die wichtigsten
und für Deutschland ersten Fährtenfunde. In den von Heßberg
bei Hildburghausen stammenden Sandsteinplatten aus dem unteren Teil des
sogenannten Thüringer Bausandsteins fand SICKLER zusammen mit seinem
Freund, dem Kupferstecher BARTH, zahlreiche gut erhaltene Ausgüsse
von Trittsiegeln eines unbekannten und offenbar sehr großen Tieres.
In einem Sendschreiben an Prof. Dr. J. F. BLUMENBACH beschrieb SICKLER
1834 diese Fährten erstmals. Ein Teil der Fährten wurde an Prof.
KAUP in Darmstadt zur Bestimmung geschickt, der es 1835 Chirotherium
(= griechisch Handtier) taufte. |
| |
| Mit den Fährten gefundene Knochen, die Prof. Fr. S. VOIGT aus
Jena in einem Artikel im Neuen Jahrbuch für Mineralogie, Geognostie,
Geologie und Petrefaktenkunde von 1835 erwähnt, wurden von den Findern
wenig beachtet und sind nicht überliefert. Ein dramatischer Verlust
für die Wissenschaft. |
| |
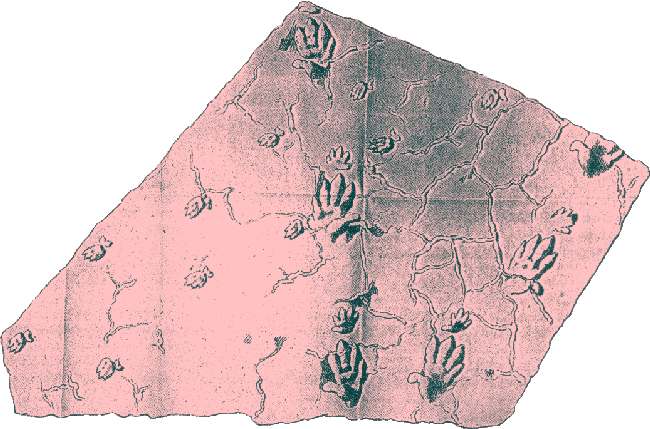 |
| |
| Bild 1: Eine der Sandsteinplatten aus dem Steinbruch von
Heßberg bei Hildburghausen. Lithografie des Hofmalers und Zeichenlehrers
KESSLER in SICKLERs Sendschreiben von 1834. Die Platte zeigt Fährten
von Chirotherium barthii (große Fährten rechts) und Chirotherium
sickleri (kleinere Fährten links). |
| |
| Vom deutschen Originalfundort gelangten Fährtenplatten in alle
Welt. In einer zweiten Schrift von 1836 führt SICKLER die naturhistorischen
Museen auf, die bereits Fundstücke von Heßberg erhalten hatten.
Darunter sind Berlin, Darmstadt, Göttingen, Gotha, Prag, London und
Paris. |
| |
| |
Erste Forschungen
|
| Erste Autoren ordneten diese Tiere drei verschiedenen Klassen der Wirbeltiere
zu, den Amphibien, den Reptilien und den Säugetieren. Nicht weniger
als zehn Tierarten glaubte man in den Fährten zu erkennen: Verschiedenste
Arten von Urweltaffen, Beuteltiere, riesige, ausgestorbene Schildkröten,
eidechsenähnliche Tiere. |
| |
| Prof. KAUP sah 1835 in den Fährten die Spuren eines Affen oder
Beuteltiers, behielt sich aber die Umwandlung des Namens in Chirosaurus
vor, falls dieses Tier ein Kriechtier oder Lurch gewesen sein sollte. |
| |
| Prof. Fr. S. VOIGT sah 1835 in den Chirotherienfährten die Spuren
eines kollossalen Affens, eines Palaeopithecus. Später deutete
VOIGT eine große Fußfährte, an der der sogenannte Daumen
fehlte, als Fährte eines Bären, vielleicht sogar des berühmten
Ursus
spelaeus selbst. Kleinere Fährten, SICKLERs Chirotherium minus,
ordnete er dem Mandrill zu. |
| |
| Auf Grund der erstmals beobachteten Hautskulptur an Funden aus dem
Oberen Buntsandstein von St. Valbert in Frankreich schließt A. DAUBREE
1857 ebenfalls auf Säugetiere. |
| |
| Die Deutung als Säugetierfährten wird jedoch schon bald aufgegeben.
Die allgemeine Meinung ging damals schon mehr in Richtung Amphibien als
Erzeuger der umstrittenen Fährten. Nachdem LINK sich 1835 für
Batrachier oder Saurier ausgesprochen hatte, nahm Prof. R. OWEN 1841 Labyrinthodonten
als Fährtenerzeuger an und gab damit den Chirotherienfährten
eine Deutung, an der viele Paläontologen lange Zeit festhielten. Er
kombinierte bekannte Knochenfunde von Amphibien aus englischen Buntsandstein-
Schichten mit den Fährtenfunden zu einer ersten Rekonstruktion in
Form eines Riesenlurchs, die der englische Geologe und Paläontologe
Sir C. LYELL 1851 präsentierte. |
| |
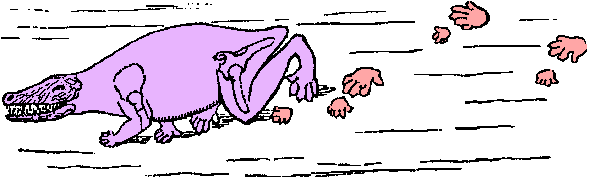 |
| |
| Bild 2: Erste Rekonstruktion des Chriotheriums
von Prof. Dr. R. OWEN als Labyrinthodont. |
| |
| |
Eine paläobiologische Studie
|
| Zu Anfang diese Jahrhunderts herrschte noch keine Einigkeit über
eine klare Deutung der in Europa gefundenen Chirotherienfährten, bis Prof.
W. SOERGEL von der Universität Tübingen im Jahre 1925 mit einer
paläobiologischen Studie neue Wege beschritt. Er beobachte an
möglichst vielen gefundenen Fährten Details und verglich diese mit
bekannten Landwirbeltieren. Er versuchte so das Leben der Chirotheria nicht nur
zu entwerfen, sondern Art, Gestalt und Lebensweise aufzubauen, um somit die
entwicklungsgeschichtliche Stellung dieser Handtiere zu sichern. |
| |
| SOERGEL sieht in den Fährtenerzeugern schlanke, hochbeinige Tiere.
Sie müssen mehreren Arten von bis zu acht Meter Länge angehört
haben. Markante Merkmale des Körperbaus waren kurze Vorderbeine und
wesentlich kräftigere, längere Hinterbeine. Letztere ermöglichten
es dem Chirotherium sich bei schnellerem Lauf auf zu richten und
nur auf den Hinterbeinen biped fort zu bewegen. Die Beine befanden sich
unter dem Körper. Der Ausbalancierung des Körpers diente ein
langer, kräftig ausgebildeter Schwanz. |
| |
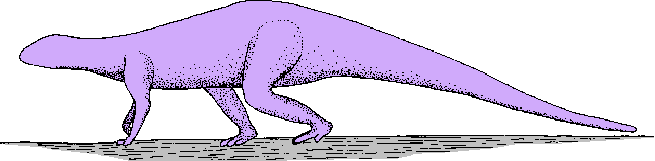 |
| |
| Bild 3: Rekonstruktion des Chirotheriums durch
Prof. W. SOERGEL. |
| |
| Auf Grund der stark bekrallten Pfoten kann als sicher angenommen werden,
dass es sich um räuberisch lebende Fleischfresser gehandelt hat, die
sich von kleineren Reptilien oder Amphibien ernährt haben. Die Co-Existenz
dieser verschiedenen Arten ist wiederholt durch Fährtenfunde belegt.
Der so genannte "Daumen" an den Hinterfußfährten deutet auf
eine kletternde Lebensweise, die sie vermutlich von kleineren, baumbewohnenden
Vorfahren geerbt haben. Der Hauptlebensraum der Chirotheria dürften
nicht die ausgetrockneten oder sandigen Gebiete im Beckeninneren gewesen
sein, sondern die gebirgigen Regionen am Rand des Buntsandstein-Beckens. |
| |
| SOERGEL kam zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Chirotherien nur
um Reptilien gehandelt haben könne und ordnete sie den Pseudosuchiern,
hochbeinigen Scheinkrokodilen aus der Ordnung der Thecodontier, zu. |
| |
| |
Die erste Bestätigungen
|
| Ausgrabungen in den 30er Jahren der 20. Jahrhunderts am Monte San Giorgio
im Tessin (Schweiz) scheinen die längst von der Wissenschaft akzeptierten
Vorstellungen SOERGELs zu bestätigen. Ein am 7. August 1933 in marinen
Schichten der Mittleren Trias gefundenes und erst 1948 präpariertes
Skelett wird einem rauisuchiden Pseudosuchier zugeschrieben, der 1965 den
Namen Ticinosuchus ferox erhielt. Es handelte sich um das Skelett
eines Land bewohnenden Tieres. Die nach dem Fossil erstellte Rekonstruktionszeichnung
von Prof. Dr. B. KREBS zeigt deutliche Ähnlichkeiten mit der hyopthetischen
Rekonstruktionszeichnung von Prof. W. SOERGEL. Auch die Rekonstuktion der
Fußskelette von Ticinosuchus ferox zeigt, das dieses Tier
als Erzeuger von Chirotherienfährten in Betracht kommt wenn nicht
sogar einer der Erzeuger ist. |
| |
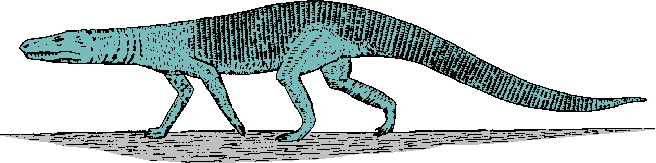 |
| |
| Bild 4: Rekonstruktion von Ticinosuchus ferox
durch Prof. Dr. B. Krebs. |
| |
| Auch auf einer Expedition nach Südbrasilien von Freiherr von HUENE
in den Jahren 1927 bis 1929 gefundene Skelett-Teile eines Pseudosuchiers,
der später den Namen Prestosuchus chiniquensis erhielt, stimmen
mit dem Denkmodell SOERGELs sehr gut überein. |
| |
| |
Neue Beweise
|
| 1990 im Rötquarzit des Oberen Buntsandsteins im Südschwarzwald
gefundene Knochen dürften entgültig den Beweis geliefert haben,
dass Rauisuchier die Erzeuger der Chirotherienfährten sind. Die Stücke
sind zur Zeit Bei Dr. R. WILD in Stuttgart in Bearbeitung. Erste Ergebnisse
deuten auf Ähnlichkeiten mit Ctenosauriscus aus dem Buntsandstein
des Bremketales bei Göttingen, von dem bislang nur die Wirbelsäule
bekannt ist. |
| |
| Ist Ctenosauriscus koeneni der Erzeuger von Chirotherienfährten?
Für die kleineren Fährten des Typs Chirotherium sickleri kommt
Ctenosauriscus von der Größe her in Frage. Dr. F.-O. HADERER
hat basierend auf der Wirbelsäule von Ctenosauriscus 1998 ein Tier
rekonstruiert, das ebenfalls mit den Vorstellungen SOERGELs überein
stimmt. Markant ist bei Ctenosauriscus ein hohes Rückensegel der extrem
verlängerten Dornfortsätze der Rückenwirbel. |
| |
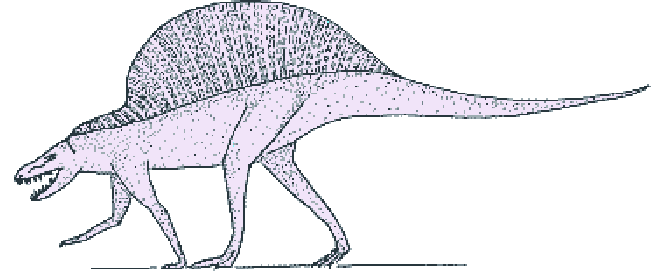 |
| |
| Bild 5: Rekonstruktion des Erzeugers der Fährten
von Chirotherium sickleri durch Dr. F.-O. HADERER basierend auf Ctenosauriscus
koeneni. |
| |
| Ob größere Chirotherien ebenfalls ein solches Rückensegel
besaßen ist fraglich. Mit Sicherheit haben mehrere Gattungen von
Pseudosuchiern Fährten erzeugt, die heute der Fährtengattung
Chirotherium zugeordnet werden. |
| |
| |
Resumee
|
| Nach rund 200 Jahren Chirotherien-Forschung deutet sich eine Lösung
des Chirotherien-Problems an. Noch nicht alle Fährten erzeugenden
Tiere sind identifiziert, doch ein Anfang ist gemacht. |
| |
| Heute sind 35 Arten von Chirotherien-Fährten bekannt, nicht nur
aus dem Buntsandstein im Sinne der Germanischen Trias, sondern auch aus
vergleichbaren Formationen der Unteren bis Oberen Trias weltweit. Fundorte
liegen in Europa (Deutschland, England, Frankreich, Spanien), Nordafrika
sowie Nord- und Südamerika. |
| |